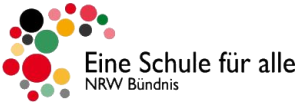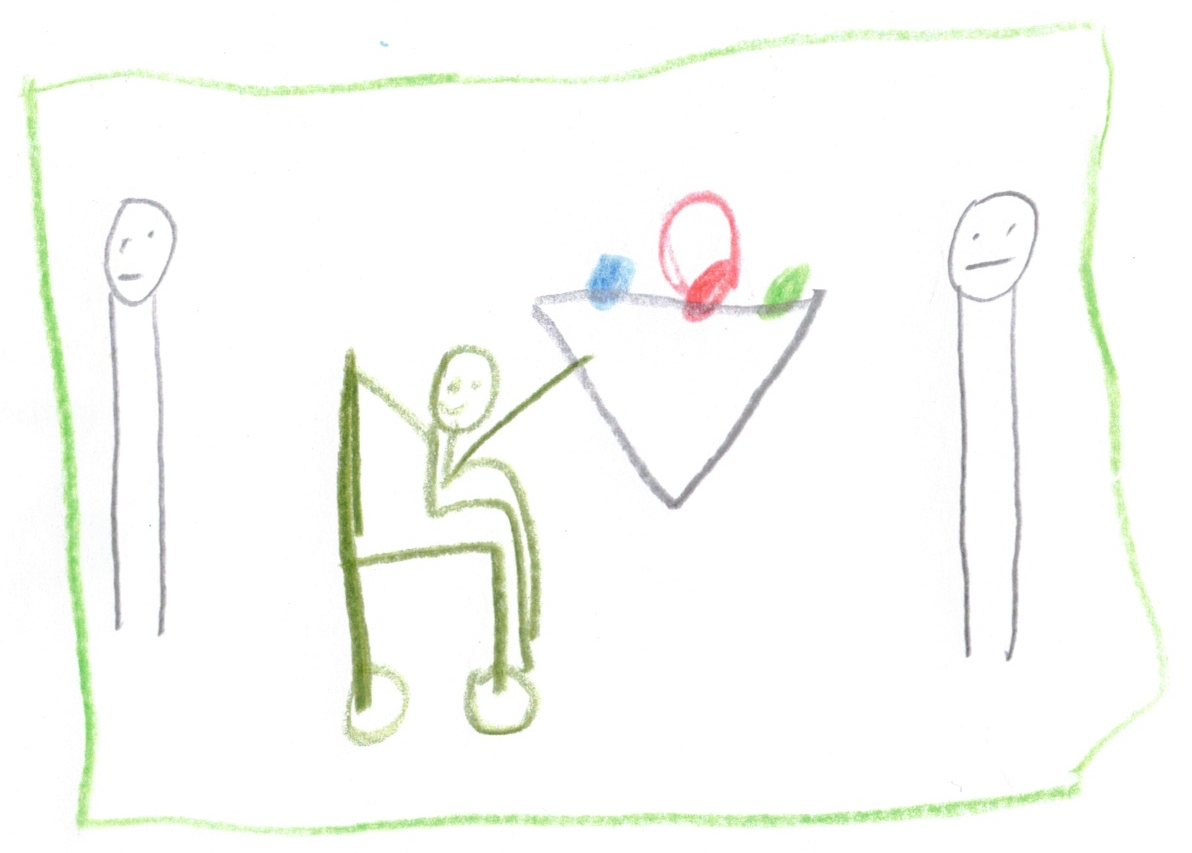 Die vorgesehene Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes in NRW verspricht Modernisierung und mehr Qualität. Gestärkt wird allerdings nicht der Stellenwert von Inklusion, sondern die Stellung der Sonderpädagogik.
Die vorgesehene Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes in NRW verspricht Modernisierung und mehr Qualität. Gestärkt wird allerdings nicht der Stellenwert von Inklusion, sondern die Stellung der Sonderpädagogik.
Eigentlich muss es in der Entwicklung eines demokratischen und inklusiven Schulsystems im 21. Jahrhundert darum gehen, die historische Abspaltung der Sonderpädagogik von der Allgemeinen Pädagogik zu überwinden und damit die inklusionswidrige strukturelle Trennung der Lehrämter für Allgemeine Pädagogik und Sonderpädagogik aufzuheben.
Zumindest sollte es im Einklang mit menschenrechtlichen Verpflichtungen bildungspolitischer Konsens sein, dass die Lehrerausbildung die Trennung nicht vertieft, sondern die Entwicklung inklusiver Einstellungen und den Erwerb von inklusivem Handlungswissen für die Unterrichts- und Schulpraxis fördert, wie Prof. Kerstin Merz-Atalik in ihrer jüngsten Buchveröffentlichung (2025) zur Lehrerausbildung herausstellt.
Der aktuelle Entwurf für das dritte Gesetz zur Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes (LABG) und die dazu gehörige Änderung der Lehramtszugangsverordnung eröffnen keine Perspektive für Inklusion. Sie machen die Sonderpädagogik zum Ausgangspunkt und Zentrum für die Neustrukturierung der Lehrkräfteausbildung in NRW.
Die Ein-Fach-Lösung
Geplant ist, das Lehramt für sonderpädagogische Förderung so umzustellen, dass zukünftig nur noch ein Unterrichtsfach neben den zwei sonderpädagogischen Förderschwerpunkten belegt werden muss. Diese Maßnahme wird damit begründet, dass mit der Reduzierung des Leistungsanspruchs die Belastung reduziert und damit ermöglicht wird, dass ein Unterrichtsfach „mit der gleichen Tiefe wie im Lehramt für Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschulen“ studiert werden kann“.
Dass mit dem Argument andere Ziele verfolgt werden, lässt sich dem Gesetzentwurf selbst entnehmen. Dort wird festgestellt: „Diese grundlegende Umstrukturierung des Studiums schafft zudem künftig breitere Möglichkeiten insbesondere für die sonderpädagogische Diagnostik und die Förderung von Basiskompetenzen.“
Außerdem spekuliert das Schulministerium darauf, dass das vereinfachte Studium für sonderpädagogische Förderung attraktiver wird und mehr Studierende für das Lehramt gewonnen werden können. „Die insgesamt bewirkte Verringerung der Komplexität des Studiums kann schließlich sowohl zur Attraktivität des Lehramts als auch einer Erhöhung des Studienerfolgs beitragen“, heißt es in der Begründung zum Entwurf.
Ausweitung der sonderpädagogischen Diagnostik
Das zweite Unterrichtsfach im Lehramtsstudium für sonderpädagogische Förderung wird „abgeräumt“, um Platz zu schaffen für noch mehr sonderpädagogische Diagnostik und „breitere Möglichkeiten“ ihres Einsatzes.
Diese breiteren Möglichkeiten sind in dem Gutachten zur Neuausrichtung des Feststellungsverfahrens in NRW der Landesregierung 2024 vorgelegt und als Empfehlungen für eine präventionsorientierte, datengestützte Steuerung der Schulentwicklung präzisiert worden.
Zu den Empfehlungen stellt Prof. Dagmar Hänsel in ihrem Aufsatz „Sonderpädagogische Diagnostik in historischer Perspektive“ (2025) kritisch fest, dass sie nicht auf die Verwirklichung von Inklusion zielen, sondern auf die „Verallgemeinerung der sonderpädagogischen Diagnostik“ ausgerichtet sind. „Sie soll nun nicht nur der formellen Feststellung des sonderpädagogischen Bedarfs bestimmter Kinder dienen und auf den Prozess der sonderpädagogischen Förderung in der allgemeinen Schule bzw. in der Sonderschule beschränkt bleiben. Vielmehr soll sie in Gestalt präventiver sonderpädagogischer Unterstützung auf alle Kinder und auf die pädagogischen Prozesse in der allgemeinen Schule ausgeweitet werden.“
Implementation sonderpädagogischer Diagnostik in die allgemeinen Lehrämter
Im Rahmen der Bildungswissenschaften sollen sich zukünftig alle Studierenden der allgemeinen Lehrämter mit dem Aufgabenfeld „Diagnose und Förderung“ befassen. Diese Maßnahme gehört zur Strategie der datengestützten Unterrichts- und Schulentwicklung, die das NRW- Schulministerium mit seinem „Schulkompass NRW 2030“ vor der Sommerpause angekündigt und eingeleitet hat.
Davon ausgehend, dass zukünftig sonderpädagogische Diagnose- und Förderprogramme für Prävention und Förderung in den Schulen zum Einsatz kommen und die Unterrichtspraxis sich an messbaren Daten über individuelle Lernstände und Lernverläufe orientieren muss, gilt es, die allgemeinen Lehrkräfte darauf vorzubereiten. Es gilt, Akzeptanz für die standardisierte und normorientierte Diagnostik zu schaffen, die mit ihrem schematischen Gleichheitsdenken im Gegensatz zur Inklusion steht.
Rückschritt in der NRW-Lehrerausbildung
In den meisten europäischen Ländern gibt es kein grundständiges Lehramt für Sonderpädagogik. Es ist in das stufenbezogene Lehramt für Primar- und Sekundarstufe integriert, wie Prof. Merz-Atalik feststellt. Selbst Österreich mit seinem selektiven Schulsystem hat das grundständige Lehramt für Sonderpädagogik abgeschafft. In Deutschland haben dagegen lediglich Berlin und Brandenburg das grundständige Lehramt in stufenbezogene Lehramtsstudiengänge integriert.
In dem grundständigen Lehramt für Sonderpädagogik ist das segregierte Professionsverständnis mit der ausschließlichen Zuständigkeit für Kinder mit Behinderungen begründet. Mit dem aktuellen Entwurf zur Lehrerausbildung in NRW wird das hochproblematische Professionsverständnis verschärft, weil das Lehramtsstudium für sonderpädagogische Förderung mit der Ausweitung der sonderpädagogischen Diagnostik ein noch stärkeres sonderpädagogisches Profil bekommt.
Dr. Brigitte Schumann 10/2025